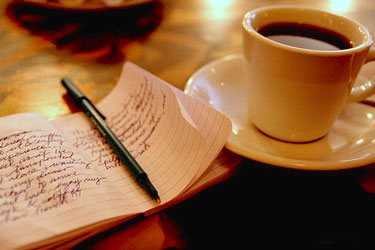Aberglaube, Bauern- und Faustregeln
22/04/25 14:23
Hommage an Peter Bichsel (1935-2025)
Peter Bichsel hat mich mit seinen Kolumnen zum Schreiben animiert.In der kolumnenverrückten Schweiz waren Bichsels Kolumnen die einzigen, deren man nie überdrüssig wurde.
Und jetzt auch noch dies: Aberglaube sei biologisch sinnvoll und könne einen Überlebensvorteil darstellen, behauptet nicht etwa ein Esoterik-Guru, sondern Peter Brugger, Biologe und Professor für Verhaltensneurologie. Da wird man ja nicht nur als naturwissenschaftlich Geschulter sondern auch als Rationalist schon etwas neugierig.
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache: Immer mal wieder ertappt man sich dabei von einem Aberglauben mitgerissen zu werden. Dann stellt sich relativ schnell ein unangenehmes Gefühl ein, weil man realisiert, dass sich dahinter ein irrationales unverständliches Phänomen versteckt. Es sind ja nicht alle Leute esoterisch veranlagt, so dass sie etwas Irrationales, Rätselhaftes bis Nebulöses zu begreifen vorgeben. Nur Eingeweihte können offenbar das alles verstehen, dessen praktischer Nutzen eher nur theoretischer Natur ist.
Seit jeher attribuieren die Menschen bestimmten Gegenständen oder Begebenheiten etwas Mystisches oder Transzendentales. Wie Tausende von Jahre alte Höhlenmalereien und Grabbeigaben suggerieren, haben sie allezeit an Spirituelles, Übersinnliches geglaubt.
Als Aberglaube wird jeder Glaube an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte in bestimmten Personen und Dingen, welche die meisten als irrsinnig abtun, definiert.
Goethe soll einmal gesagt haben: «Aberglaube ist die Poesie des Lebens.»
Aberglaube ist der Glaube an das Übersinnliche. Er entstand Ende des Mittelalters in der christlichen Religion. Von der Kirche wurde er als unchristlich verurteilt. Mit der Diskriminierung des Aberglaubens wollte sich die geistliche Macht elegant reformatorische und sektiererische Einflüsse vom Leibe halten. Der Vorwurf des Aberglaubens richtete sich insbesondere gegen Kritiker der Kirche und Reformatoren ebenso wie gegen Naturwissenschaftler, die das Weltbild der Kirche in Frage stellten.
Der Glaube an nicht Erklärbares war im Mittelalter sehr ausgeprägt.
Mit dem Begriff Aberglaube redete die Kirche diejenigen Menschen schlecht, welche nicht ganz nach der kirchlichen Glaubenslehre lebten und eher an Zauber, Amulette und heilige Bäume glaubten.
Der Sozialpsychologe Judd Marmor definiert Aberglauben als Glaubenssätze und Praktiken, die einer wissenschaftlichen Grundlage entbehren und nicht dem Kenntnisstand der Gesellschaft entsprechen zu der man gehört.
Für Psychologen - und eben neuerdings auch für Verhaltensneurologen - ist Aberglaube jedoch etwas Normales. Die Volkskunde wiederum attestiert dem Aberglauben verlorenes Kulturgut unserer Vorfahren oder Überbleibsel einer veralteten Wissenschaft, die früher einmal aktuell und anerkannt war. Die Grenze zwischen Aberglaube und kulturellen Traditionen ist fliessend.
Praktisch in allen Kulturen der Menschheit von der Antike bis zur Gegenwart wurden oder werden irgendwelche unsichtbare, ungreifbare Götter oder Götzen angebetet oder Kultgegenstände verehrt, gepriesen oder gehuldigt. Mit zum Teil verqueren, kannibalischen Ritualen wollte man das Böse abwenden oder die Gunst der Götter erheischen.
Selbst im aufgeklärten 21. Jahrhundert begleitet uns der Aberglaube auf Schritt und Tritt. Mich jedenfalls auch. Als Kind war ich unbeirrbar davon überzeugt, dass mein Schluckauf vergehen würde, wenn ich nur -ohne Luft zu holen - genügend oft « Hitzgi, Hätzgi hinder em Hag, nimm mer au das Hitzgi ab.» sagen konnte.
Und noch heute bediene ich mich des Aberglaubens um zu versuchen etwas Wünschenswertes herbeizubeschwören oder etwas Vermaledeits von mir fernzuhalten.
Kaum ein Tag vergeht, an dem wir nicht mit den Symbolen, Riten und Bräuchen des Aberglaubens in Berührung kommen. Obwohl der Mensch grundsätzlich ein vernunftbegabtes Wesen ist, so hat er heute wie damals auch irrationale Bedürfnisse.
Mythologie und Magie sind zwei Grundpfeiler des Aberglaubens. Die Mythologie führte schon früh in der Geschichte der Menschheit dazu Irdisches und Überirdisches, Unbedeutendes und Bedeutendes sowie Mikrokosmos und Makrokosmos in Zusammenhang zu bringen. Magie wiederum sind ausgerufene Verwünschungen, gemurmelte Zaubersprüche, gemalte Zeichen und geschriebene Zauberformeln.
Die Beobachtung von Zeichen ist die populärste Form des Aberglaubens.
Aberglaube kommt aus einer Urangst vor etwas Dämonischem oder Bedrohlichem. Wenn diese Angst an etwas festgemacht wird, so nimmt dies einen Teil des Schreckens. Im Alltag hilft es, seine Ängste und Sorgen an ein Symbol zu knüpfen, das macht das Unglück verständlich und vor allem erklärbar. Aberglaube entsteht durch die falsche Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Aber lieber einmal etwas zu viel interpretieren als zu wenig – das bietet einen Überlebensvorteil. So ist Aberglaube biologisch durchaus sinnvoll.
Weit verbreitet ist der Brauch Holz zu berühren oder darauf zu klopfen, um Unglück abzuwehren. In der Regel wird er jedoch durchgeführt, wenn jemand eine besonders optimistische Aussage getroffen hat oder wenn über Zukunftspläne gesprochen wird, da das Klopfen auf Holz bevorstehendes Unheil abwenden soll. In England und Australien berühren die Menschen das Holz lediglich, während in den meisten anderen Ländern darauf geklopft wird. Die Zahl, wie oft man das Holz berühren oder darauf klopfen muss, variiert. Vielerorts reicht es, einmal zu klopfen. In Deutschland, Georgien, Portugal und Brasilien muss man dreimal klopfen, während in Irland zwei Klopfer ausreichend sind. In Dänemark klopfen die Menschen dreimal unter einen Tisch. Auch die Art des Holzes kann eine Rolle spielen. Manche klopfen auf jegliche hölzerne Oberfläche, während andere daran festhalten, dass diese frei von Farbe oder Lack sein muss um zu wirken. In manchen Gegenden Südamerikas und in Bulgarien darf das Holz keine Beine haben. In Russland reicht klopfen allein nicht aus. Es als notwendig erachtet, sich danach dreimal über die linke Schulter zu spucken. In Malaysia muss man zunächst auf Holz und danach gegen die eigene Stirn klopfen.
In einer ironischen Verdrehung klopfen hierzulande manche Menschen gegen ihre eigene Stirn, wenn gerade kein Holz in der Nähe ist.
Aber seien Sie ehrlich, was möchten Sie nun lieber: Eine schwarze Katze, die Ihnen von rechts über die Strasse läuft oder unter einer Leiter hindurchgehen?
Aus den Wetterbeobachtungen entstanden im Laufe vieler Jahre Reime und Sprüche, welche auch als Bauernregeln bekannt sind. Bauernregeln sind gereimte Volkssprüche, die das Wetter vorhersagen und auf mögliche Konsequenzen für die Landwirtschaft, die Natur und die Menschen verweisen. Sie waren einst für die Landbevölkerung überlebenswichtig, denn das Wetter entschied über eine gute oder schlechte Ernte. Wetterregeln waren bereits im Altertum bekannt und kommen unter anderem in den «Fasti» des römischen Dichters Ovid vor. Aus der Verknüpfung von meteorologischen Beobachtungen mit volkstümlichen, volksreligiösen und abergläubischen Wetterprognosen entstandene Bauernregeln waren im deutschsprachigen Raum schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts verbreitetet. Die aus Beobachtungen nacheinander folgender Umstände entstandenen Bauernregeln wurden über Generationen weitergegeben.
In den Bauernregeln ist sie so prominent wie kaum eine andere Heilige: Die heilige Sophie. «Pflanze nie – vor der Kalten Sophie!» lautet eine solche Regel, denn mit der «Kalten Sophie» ist die Gefahr der Boden- und Nachtfröste vorbei. «Vor Nachtfrost du nicht sicher bist – bis Sophie vorüber ist.» Oder nicht weniger holprig gereimt, aber salopper formuliert: «Die Kalte Sophie – macht alles hie.» Im Mittelalter orientierten sich die Bauern in der Regel nach den Heiligentagen, wenn es um den richtigen Zeitpunkt für Saat oder Ernte ging. Dabei stellten sie fest, dass es Mitte Mai oft noch einmal bitterkalt werden konnte, bevor dann der Frühsommer einsetze. Diese Tage nannten sie die Eisheiligen. In unserer Gegend sind das vier. Der erste, Pankratius, fällt auf den 12. Mai, die Kalte Sophie macht am 15. Mai dann den Abschluss des Reigens.
Eine Bauernregel versucht, aus bestimmten Wetterlagen Vorhersagen und Rückschlüsse auf später kommende Ereignisse zu treffen. Die meisten Bauernregeln befassen sich mit einer mittelfristigen Wettervorhersage. Wohl eine der berühmtesten Bauernregeln lautet: «Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich's Wetter oder es bleibt wie es ist.» Irgendein Scherzkeks liess sich offenbardavon inspirieren und kreierte folgende Bauernregel: «Ist der Hahn heiser, kräht er morgens etwas leiser.»
Die Faustregel wiederum ist eine Methode, um ohne komplizierte Berechnungen, einen Wert zu ermitteln. Das Ergebnis ist nicht genau, aber ausreichend für das Vorhaben. Wie der Begriff entstand, ist nicht genau geklärt. Das Synonym Daumenregel ist eine Lehnübersetzung vom Englischen «rule of thumb». Die Berechnungen, die eine Faustregel beinhaltet, sind immer so einfach, dass sie sich auch schnell durch Kopfrechnen bestimmen lassen. Die meisten Faustregeln resultieren aus Erfahrungen. Man kann unterscheiden zwischen Faustregeln, die Erfahrungswerte kennzeichnen, ohne dass es überhaupt ein exaktes Rechenverfahren gibt, und Faustregeln, die Abschätzungen ermöglichen, wenn die exakte Berechnung zu lange dauern würde oder im Kopf nicht durchführbar wäre. Wissenschaftlich werden Faustregeln in der Kognitionswissenschaft, der Künstlichen Intelligenz und der Informatik unter dem Begriff Heuristik untersucht.
Beispiele gibt es wie Sand am Meer: Etwa die „Pareto-Regel oder 20/80-Regel“, welche besagt, dass mit 20 % der Kunden 80 % des Umsatzes erwirtschaftet werden, 20 % der Produkte für 80 % der Reklamationen verantwortlich sind, 20 % der Fehlerursachen 80 % der Fehler nach sich ziehen oder 20 % der Produktionsmittel 80 % der Kosten verursachen.
Eine sinnvolle und nützliche Faustregel hilft bei Gewitter die Entfernung des Unwetters durch den Abstand von Blitz und Donner in Sekunden zu ermitteln. Nach dem Blitz zählt man die Sekunden, bis der Donner zu hören ist. Das Ergebnis teilt man durch drei und erhält so die Entfernung in Kilometern.
Die meisten Faustregeln für Geld und Finanzen sind in der Tat ziemlich nützlich, zum Beispiel die «Eigenheimformel». Diese Faustregel besagt, dass Eigentümer jedes Jahr ein Prozent des aktuellen Immobilienwertes auf einem separaten Konto für Reparatur und Wartung zurücklegen sollten. Oder etwa die «Anschaffungsregel», die darüber entscheidet ob etwas repariert oder neu gekauft werden soll, wenn zum Beispiel der Fernseher, die Waschmaschine oder ein Kühlschrank defekt ist. Diese Regel besagt, dass Sie ein neues Gerät kaufen sollten, wenn es mehr als 8 Jahre auf dem Buckel oder falls die Reparatur mehr als die Hälfte dessen verschlingt, was ein neues Gerät kostet.
Ist Ihnen bewusst, dass es eine Faustregel zur Beantwortung der Frage gibt, ob man am richtigen Ort wohne? Bei dieser Faustregel handelt es sich um den berühmten „Eis-am-Stiel-Test“ (bekannt auch unter seinem englischen Namen « popsicle test »). Der Test beinhaltet die Antwort auf folgende Frage: Ist ein achtjähriges Kind in der Lage, sicher von zu Hause zu einem Glaceladen zu gehen, ein Glace zu kaufen und nach Hause zurückzukehren, bevor das Glace schmilzt? Falls Ihre Antwort Ja ist, wohnen Sie mehr oder weniger am richtigen Ort. Falls sie Nein lautet, sollten Sie zügeln. Das Geniale an dem Test ist seine unmissverständliche Ausgangsprämisse: Wenn es für ein achtjähriges Kind stimmt, stimmts auch für alle anderen. Denn was wirklich wichtig ist bei der Wahl des Wohnorts ist die Lage. Klar, aber was heisst « gute Lage »? Dass die Liegenschaft in zwanzig Jahren mehr wert ist? Nein! „Gute Lage“ heisst: a) dass die Gegend so sicher ist, dass sogar ein Kind allein auf der Strasse herumlaufen kann, was wiederum heisst, dass bedrohlicher Autoverkehr und miese Gestalten keinen Vorrang haben, b) dass es in der Nähe einen netten Laden gibt, wo Glaces verkauft werden. Dies bedeutet, dass die Leute in der Gegend etwas vom grossen Glück im Kleinen verstehen.
Auf Tiktok kursiert seit letztem Herbst die «30-30-30-Regel». Eine Faustregel zum Abnehmen. Sie geht so: Innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Aufstehen 30 Gramm Protein zu sich nehmen und dann 30 Minuten zügiges Gehen.
Apropos Essen, eine Faustregel bezüglich Streukäse lautet: Wenn man sieht was darunter ist, so ist es zu wenig.
Zum Schluss noch eine Faustregel, die komplett falsch ist: Wenn ein Mann seiner Frau die Wagentür öffnet, ist entweder der Wagen neu oder die Frau.
Der Sozialpsychologe Judd Marmor definiert Aberglauben als Glaubenssätze und Praktiken, die einer wissenschaftlichen Grundlage entbehren und nicht dem Kenntnisstand der Gesellschaft entsprechen zu der man gehört.
Für Psychologen - und eben neuerdings auch für Verhaltensneurologen - ist Aberglaube jedoch etwas Normales. Die Volkskunde wiederum attestiert dem Aberglauben verlorenes Kulturgut unserer Vorfahren oder Überbleibsel einer veralteten Wissenschaft, die früher einmal aktuell und anerkannt war. Die Grenze zwischen Aberglaube und kulturellen Traditionen ist fliessend.
Praktisch in allen Kulturen der Menschheit von der Antike bis zur Gegenwart wurden oder werden irgendwelche unsichtbare, ungreifbare Götter oder Götzen angebetet oder Kultgegenstände verehrt, gepriesen oder gehuldigt. Mit zum Teil verqueren, kannibalischen Ritualen wollte man das Böse abwenden oder die Gunst der Götter erheischen.
Selbst im aufgeklärten 21. Jahrhundert begleitet uns der Aberglaube auf Schritt und Tritt. Mich jedenfalls auch. Als Kind war ich unbeirrbar davon überzeugt, dass mein Schluckauf vergehen würde, wenn ich nur -ohne Luft zu holen - genügend oft « Hitzgi, Hätzgi hinder em Hag, nimm mer au das Hitzgi ab.» sagen konnte.
Und noch heute bediene ich mich des Aberglaubens um zu versuchen etwas Wünschenswertes herbeizubeschwören oder etwas Vermaledeits von mir fernzuhalten.
Kaum ein Tag vergeht, an dem wir nicht mit den Symbolen, Riten und Bräuchen des Aberglaubens in Berührung kommen. Obwohl der Mensch grundsätzlich ein vernunftbegabtes Wesen ist, so hat er heute wie damals auch irrationale Bedürfnisse.
Mythologie und Magie sind zwei Grundpfeiler des Aberglaubens. Die Mythologie führte schon früh in der Geschichte der Menschheit dazu Irdisches und Überirdisches, Unbedeutendes und Bedeutendes sowie Mikrokosmos und Makrokosmos in Zusammenhang zu bringen. Magie wiederum sind ausgerufene Verwünschungen, gemurmelte Zaubersprüche, gemalte Zeichen und geschriebene Zauberformeln.
Die Beobachtung von Zeichen ist die populärste Form des Aberglaubens.
Aberglaube kommt aus einer Urangst vor etwas Dämonischem oder Bedrohlichem. Wenn diese Angst an etwas festgemacht wird, so nimmt dies einen Teil des Schreckens. Im Alltag hilft es, seine Ängste und Sorgen an ein Symbol zu knüpfen, das macht das Unglück verständlich und vor allem erklärbar. Aberglaube entsteht durch die falsche Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Aber lieber einmal etwas zu viel interpretieren als zu wenig – das bietet einen Überlebensvorteil. So ist Aberglaube biologisch durchaus sinnvoll.
Weit verbreitet ist der Brauch Holz zu berühren oder darauf zu klopfen, um Unglück abzuwehren. In der Regel wird er jedoch durchgeführt, wenn jemand eine besonders optimistische Aussage getroffen hat oder wenn über Zukunftspläne gesprochen wird, da das Klopfen auf Holz bevorstehendes Unheil abwenden soll. In England und Australien berühren die Menschen das Holz lediglich, während in den meisten anderen Ländern darauf geklopft wird. Die Zahl, wie oft man das Holz berühren oder darauf klopfen muss, variiert. Vielerorts reicht es, einmal zu klopfen. In Deutschland, Georgien, Portugal und Brasilien muss man dreimal klopfen, während in Irland zwei Klopfer ausreichend sind. In Dänemark klopfen die Menschen dreimal unter einen Tisch. Auch die Art des Holzes kann eine Rolle spielen. Manche klopfen auf jegliche hölzerne Oberfläche, während andere daran festhalten, dass diese frei von Farbe oder Lack sein muss um zu wirken. In manchen Gegenden Südamerikas und in Bulgarien darf das Holz keine Beine haben. In Russland reicht klopfen allein nicht aus. Es als notwendig erachtet, sich danach dreimal über die linke Schulter zu spucken. In Malaysia muss man zunächst auf Holz und danach gegen die eigene Stirn klopfen.
In einer ironischen Verdrehung klopfen hierzulande manche Menschen gegen ihre eigene Stirn, wenn gerade kein Holz in der Nähe ist.
Aber seien Sie ehrlich, was möchten Sie nun lieber: Eine schwarze Katze, die Ihnen von rechts über die Strasse läuft oder unter einer Leiter hindurchgehen?
Aus den Wetterbeobachtungen entstanden im Laufe vieler Jahre Reime und Sprüche, welche auch als Bauernregeln bekannt sind. Bauernregeln sind gereimte Volkssprüche, die das Wetter vorhersagen und auf mögliche Konsequenzen für die Landwirtschaft, die Natur und die Menschen verweisen. Sie waren einst für die Landbevölkerung überlebenswichtig, denn das Wetter entschied über eine gute oder schlechte Ernte. Wetterregeln waren bereits im Altertum bekannt und kommen unter anderem in den «Fasti» des römischen Dichters Ovid vor. Aus der Verknüpfung von meteorologischen Beobachtungen mit volkstümlichen, volksreligiösen und abergläubischen Wetterprognosen entstandene Bauernregeln waren im deutschsprachigen Raum schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts verbreitetet. Die aus Beobachtungen nacheinander folgender Umstände entstandenen Bauernregeln wurden über Generationen weitergegeben.
In den Bauernregeln ist sie so prominent wie kaum eine andere Heilige: Die heilige Sophie. «Pflanze nie – vor der Kalten Sophie!» lautet eine solche Regel, denn mit der «Kalten Sophie» ist die Gefahr der Boden- und Nachtfröste vorbei. «Vor Nachtfrost du nicht sicher bist – bis Sophie vorüber ist.» Oder nicht weniger holprig gereimt, aber salopper formuliert: «Die Kalte Sophie – macht alles hie.» Im Mittelalter orientierten sich die Bauern in der Regel nach den Heiligentagen, wenn es um den richtigen Zeitpunkt für Saat oder Ernte ging. Dabei stellten sie fest, dass es Mitte Mai oft noch einmal bitterkalt werden konnte, bevor dann der Frühsommer einsetze. Diese Tage nannten sie die Eisheiligen. In unserer Gegend sind das vier. Der erste, Pankratius, fällt auf den 12. Mai, die Kalte Sophie macht am 15. Mai dann den Abschluss des Reigens.
Eine Bauernregel versucht, aus bestimmten Wetterlagen Vorhersagen und Rückschlüsse auf später kommende Ereignisse zu treffen. Die meisten Bauernregeln befassen sich mit einer mittelfristigen Wettervorhersage. Wohl eine der berühmtesten Bauernregeln lautet: «Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich's Wetter oder es bleibt wie es ist.» Irgendein Scherzkeks liess sich offenbardavon inspirieren und kreierte folgende Bauernregel: «Ist der Hahn heiser, kräht er morgens etwas leiser.»
Die Faustregel wiederum ist eine Methode, um ohne komplizierte Berechnungen, einen Wert zu ermitteln. Das Ergebnis ist nicht genau, aber ausreichend für das Vorhaben. Wie der Begriff entstand, ist nicht genau geklärt. Das Synonym Daumenregel ist eine Lehnübersetzung vom Englischen «rule of thumb». Die Berechnungen, die eine Faustregel beinhaltet, sind immer so einfach, dass sie sich auch schnell durch Kopfrechnen bestimmen lassen. Die meisten Faustregeln resultieren aus Erfahrungen. Man kann unterscheiden zwischen Faustregeln, die Erfahrungswerte kennzeichnen, ohne dass es überhaupt ein exaktes Rechenverfahren gibt, und Faustregeln, die Abschätzungen ermöglichen, wenn die exakte Berechnung zu lange dauern würde oder im Kopf nicht durchführbar wäre. Wissenschaftlich werden Faustregeln in der Kognitionswissenschaft, der Künstlichen Intelligenz und der Informatik unter dem Begriff Heuristik untersucht.
Beispiele gibt es wie Sand am Meer: Etwa die „Pareto-Regel oder 20/80-Regel“, welche besagt, dass mit 20 % der Kunden 80 % des Umsatzes erwirtschaftet werden, 20 % der Produkte für 80 % der Reklamationen verantwortlich sind, 20 % der Fehlerursachen 80 % der Fehler nach sich ziehen oder 20 % der Produktionsmittel 80 % der Kosten verursachen.
Eine sinnvolle und nützliche Faustregel hilft bei Gewitter die Entfernung des Unwetters durch den Abstand von Blitz und Donner in Sekunden zu ermitteln. Nach dem Blitz zählt man die Sekunden, bis der Donner zu hören ist. Das Ergebnis teilt man durch drei und erhält so die Entfernung in Kilometern.
Die meisten Faustregeln für Geld und Finanzen sind in der Tat ziemlich nützlich, zum Beispiel die «Eigenheimformel». Diese Faustregel besagt, dass Eigentümer jedes Jahr ein Prozent des aktuellen Immobilienwertes auf einem separaten Konto für Reparatur und Wartung zurücklegen sollten. Oder etwa die «Anschaffungsregel», die darüber entscheidet ob etwas repariert oder neu gekauft werden soll, wenn zum Beispiel der Fernseher, die Waschmaschine oder ein Kühlschrank defekt ist. Diese Regel besagt, dass Sie ein neues Gerät kaufen sollten, wenn es mehr als 8 Jahre auf dem Buckel oder falls die Reparatur mehr als die Hälfte dessen verschlingt, was ein neues Gerät kostet.
Ist Ihnen bewusst, dass es eine Faustregel zur Beantwortung der Frage gibt, ob man am richtigen Ort wohne? Bei dieser Faustregel handelt es sich um den berühmten „Eis-am-Stiel-Test“ (bekannt auch unter seinem englischen Namen « popsicle test »). Der Test beinhaltet die Antwort auf folgende Frage: Ist ein achtjähriges Kind in der Lage, sicher von zu Hause zu einem Glaceladen zu gehen, ein Glace zu kaufen und nach Hause zurückzukehren, bevor das Glace schmilzt? Falls Ihre Antwort Ja ist, wohnen Sie mehr oder weniger am richtigen Ort. Falls sie Nein lautet, sollten Sie zügeln. Das Geniale an dem Test ist seine unmissverständliche Ausgangsprämisse: Wenn es für ein achtjähriges Kind stimmt, stimmts auch für alle anderen. Denn was wirklich wichtig ist bei der Wahl des Wohnorts ist die Lage. Klar, aber was heisst « gute Lage »? Dass die Liegenschaft in zwanzig Jahren mehr wert ist? Nein! „Gute Lage“ heisst: a) dass die Gegend so sicher ist, dass sogar ein Kind allein auf der Strasse herumlaufen kann, was wiederum heisst, dass bedrohlicher Autoverkehr und miese Gestalten keinen Vorrang haben, b) dass es in der Nähe einen netten Laden gibt, wo Glaces verkauft werden. Dies bedeutet, dass die Leute in der Gegend etwas vom grossen Glück im Kleinen verstehen.
Auf Tiktok kursiert seit letztem Herbst die «30-30-30-Regel». Eine Faustregel zum Abnehmen. Sie geht so: Innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Aufstehen 30 Gramm Protein zu sich nehmen und dann 30 Minuten zügiges Gehen.
Apropos Essen, eine Faustregel bezüglich Streukäse lautet: Wenn man sieht was darunter ist, so ist es zu wenig.
Zum Schluss noch eine Faustregel, die komplett falsch ist: Wenn ein Mann seiner Frau die Wagentür öffnet, ist entweder der Wagen neu oder die Frau.